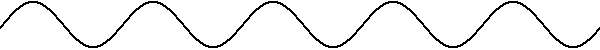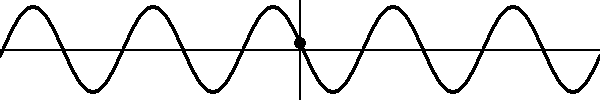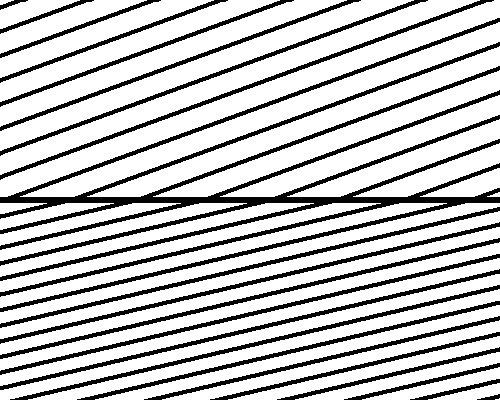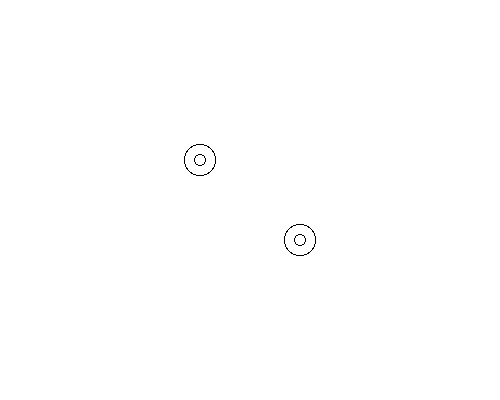1.2. Wellenoptik
Eine Welle breitet sich mit Geschwindigkeit c (lat. celeritas) aus. Der einfachste Wellentyp ist die harmonische Welle (Sinuswelle). Sie hat die Wellenlänge λ (Abstand Wellenberg-Wellenberg):
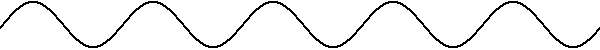
Licht ist eine elektromagnetische Welle, d.h. was sich ausbreitet sind elektrische und magnetische Felder. Nach der klassischen Elektrodynamik ist Licht verwandt mit Radio-, Mikro- und Röntgenwellen. Alle elektromagnetischen Wellen haben im Vakuum dieselbe Ausbreitungsgeschwindigkeit:
c = 299 792 458 m/s
Läuft eine Welle an einem Punkt im Raum vorbei, so schwingt dort die Messgrösse um die Nulllage herum. Die Messgrösse beim Licht wäre die elektrische Feldstärke. Die Schwingung hat die Frequenz f (Anzahl Schwingungen pro Zeiteinheit).
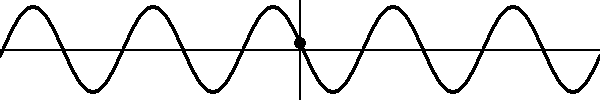
Wellengeschwindigkeit c, Wellenlänge λ und Frequenz f hängen zusammen:
c = λ f
Tritt Licht vom Vakuum in ein durchsichtiges Material ein (z.B. Glas), so wird es langsamer. Da aber die Freqenz gleich bleibt, muss die Wellenlänge kürzer werden. Tritt Licht aus der Luft in Wasser ein, so wird es 1.33 mal langsamer (Fizeau, 1850). Der Faktor 1.33 ist der absolute Brechungsindex. Die folgende Animation zeigt, wie die Wellenfronten (z.B. Wellenberge) abknicken und näher zu einander rücken, wenn die Welle in ein Medium mit tieferer Wellengeschwindigkeit eintritt.
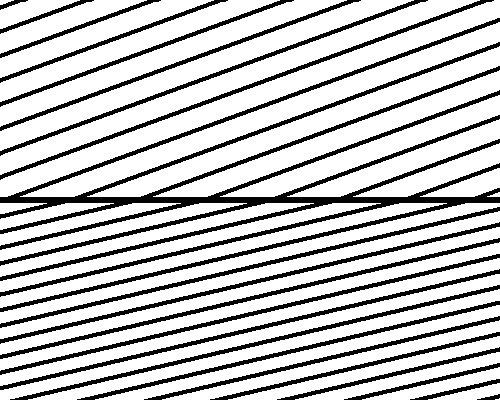
Treffen Wellen im Raum aufeinander, so laufen sie durcheinander hindurch.
(Prinzip der ungestörten Überlagerung oder Superpostion).
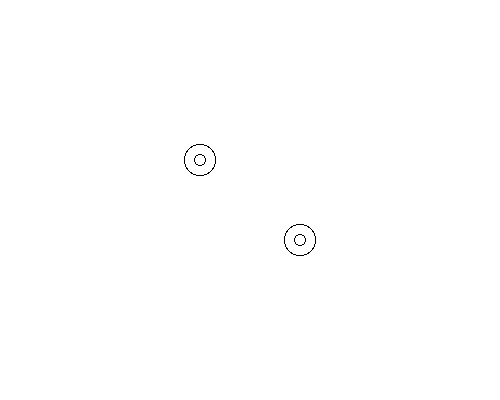
Typische Welleneigenschaften sind Interferenz und Beugung.
Laufen zwei Wellen über einander hinweg, so kann man die Momentanwerte der zwei Wellen addieren (Prinzip der linearen Superposition). Dann gibt es Stellen, wo sich die zwei Wellen gegenseitig verstärken (konstruktive Interferenz) und Stellen, wo sie sich auslöschen (destruktive Interferenz).

Läuft eine ebene Wellen gegen eine Blende mit einem Spalt, so hat sie hinter der Öffnung alle Richtungen. Man sagt, die Welle werde gebeugt. Die gebeugte Welle ist viel schwächer als die einfallende Welle.

Nach der klassischen Elektrodynamik entstehen elektromagnetische Wellen, wenn eine elektrische Ladung beschleunigt wird. Das ist z.B. in einer Antenne der Fall, wenn man sie zu Schwingungen anregt. Die ersten technischen Radiowellen wurden von Heinrich Hertz im Jahr 1884 erzeugt.
Rückwärts
Inhaltsverzeichnis
Vorwärts